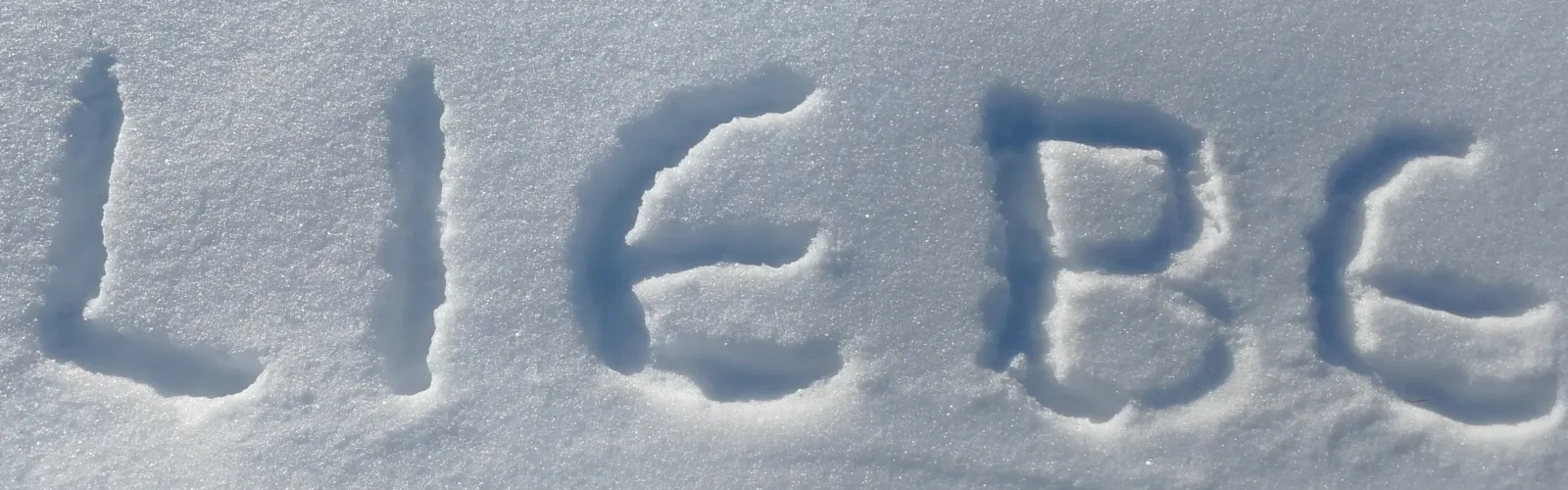Zum Lesen
Gedanken zur Jahreslosung, von Pfarrer Michael Jäger (2025_12)
„… ich mache alles neu.“
Oh weh neu. Nein, neu ist für mich nicht automatisch toll. Die neue Milkaschokolade hat den alten Preis behalten und neu nur noch 90 Gramm.
In meiner Zeitrechnung geht das 6. Jahr zuende, auf dessen weltpolitische Neuerungen ich großenteils gerne verzichtet hätte. Corona, Angriffskrieg Rußlands, Gaza-Zerstörung, Trump II. Neu geworden ist, dass man auf Moral, Mitgefühl, Anstand und Schutz der Schwachen offenbar getrost verzichten kann, ohne dass einem das irgendwie negativ angerechnet werden würde. Im Gegenteil. Das Recht des Stärkeren übt Faszination aus. Kettensägen, toll. Nicht die Verdinglichung von Lebewesen in der Massentierhaltung ist das Problem, sondern der Begriff „vegane Wurst“. Da muss man erst mal drauf kommen. Respekt.
Mein Familienstand wird 22 Jahre alt, unser Auto 10, von mir aus muss da gar nichts neu werden. Naja, ein bisschen neu gefällt mir schon. Für nächsten Sommer haben wir ein neues Urlaubsziel in der Planung. Wir sind schon gespannt. Aber das nimmt nichts von der alten Liebe zu Italien. Da wird uns ja auch mit dem Neuen nichts genommen. Bewährtes altes plus ein bisschen neues. So gefällt es mir. Hingegen das alte einfach durch neues ersetzen, gar nicht gerne.
Nun verheißt die Jahreslosung 2026, dass Gott alles neu macht. Wie gesagt, ich hätte gerade fast ein bisschen genug vom Neuen. Und die Wiederkunft Gottes, die für das gänzlich Neue steht, müsste sich für mich nicht schon in den nächsten Jahren ereignen. Also ich hätte Zeit.
Jahreslosungen, wie überhaupt die Losungen, sind isolierte Verse und deshalb wie alles Einsame hoch gefährdet. Ohne Zusammenhang, da kann man lustig hineindeuteln, der eine so, die andere anders.
Erst die Verse vorher geben der Jahreslosung ihre Klasse. Gott verspricht da, dass er abwischen wird alle Tränen, und dass weder Tod, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerzen mehr sein werden. So also sieht das Neue aus. Da kann ich nur staunen. Offener Mund.
Und wenn das Gottes Idee ist, dann könnte sie doch auch zu unserem Streben werden. 2026 Tränen abwischen, als gäbe es kein Morgen. Trösten, einfach Mensch sein, menschlich, sich nicht abfinden mit all dem Dreck, der dreist von sich gegeben wird. Auch der Schöpfung und ihren Geschöpfen, Gottes geniales Werk, die Würde wieder zurück geben. Überhitzung raus nehmen, von der Erde und auch aus unseren Debatten. All den negativen Mächten, deren Namen wir längst kennen und die in der Offenbarung mit Tod, Leid, Geschrei und Schmerzen zusammen gefasst sind, entschlossen entgegen treten.
Eigentlich mag ich es nicht, wenn Kirche so appellativ daher kommt. Aber noch weniger würde mir ein allein auf seine Traditionen fokussiertes Christentum gefallen. Natürlich sich in den kirchlichen vier Wänden vergewissern, dass Gott alles neu machen wird, aber dann … raus. Jesus hat an den Hecken und Zäunen das Reich Gottes verkündet und uns genau dort hin geschickt. Mit auf den Weg gegeben, wer sich wirklich glücklich nennen kann. Erlebbar gemacht, was heil sein bedeutet, wie umfassend das eigentlich von Gott gemeint ist.
Schneeschmelze, wenn die Sonne der Gerechtigkeit scheint. Gefrorenes taut auf. Kälte weicht. Viele kleine Sturzbäche. Mitreißendes Leben. Frühlingsluft. Liebe grünt auf.
So darf für mich gerne alles neu werden. Oh ja neu.
„Gott spricht: Siehe, ich mache alles neu!“ Offb. 21,5
Ein Engel wie Feuer und Schnee gleichzeitig, von Pfarrer Michael Jäger (2025_12)
– Artikel für Christen unterwegs –
Zu mir kam letzthin ein Engel. Glaubt ihr nicht? Ach, gebt doch meiner kleinen Weihnachtsgeschichte eine Chance. Da steckt schon was wahres drin, glaubt mir.
Doch der Reihe nach.
Ich muss ein bisschen umständlich anfangen und mal kurz grundsätzlich werden. Es ist ja nicht so, dass alle Menschen Weihnachten mögen, feiern, herbeisehnen, was auch immer. Die Kirchen werden leerer, zumindest bei uns, wissen wir, und auch wer dazu gehört, oder gar an Weihnachten in die Kirche geht, muss ja noch lange nicht weihnachtlich gestimmt sein. Wie sähe das überhaupt aus?
Gründe, mit Weihnachten im Moment nicht so viel anfangen zu können, gibt es ja genügend. Weil einer fehlt, der immer da war, weil man fern von irgendeinem zuhause ist, das Heimat geben könnte, weil Drohnen fliegen, oder der Magen knurrt, oder eine dumme Krankheit in Körper oder Seele einfach alles kaputt macht.
Ach ja, und auch die gibt es, die Weihnachten grundsätzlich schon mögen, aber es immer auch ein wenig mit Stress verbinden. Familienfeste sind wirklich nichts für Anfänger. Hohe Erwartungen bescheren eine entsprechende Fallhöhe. Und wenn man noch nebenbei arbeiten muss an Weihnachten, wird es auch nicht besser. Bei evangelischen Pfarrern etwa, da warten die Kinder ungeduldig auf eine Bescherung mit begeisternden Geschenken, und jeder einzelne Besucher erwartet vom Gottesdienst vorher auch nicht viel weniger.
Nun, dass hier gewisse Herausforderungen liegen, muss irgendwo bekannt gewesen sein, und so kam dieser Tage ein Engel bei mir zu Besuch. Den Tag habe ich nicht mehr genau parat, nur dass ich mir dachte, es passt gerade gar nicht. So richtig aufgeräumt war weder die Wohnung, noch ich.
Der Engel war groß, und wie Feuer und Schnee gleichzeitig. Er sagte zunächst nichts. Dann fragte er, ob er mich umarmen dürfe. Er lächelte mich dabei an. Da konnte ich irgendwie gar nicht anders, als stumm nicken.
Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es nun aus mir herausbrach. Tränen und Sorgen und Traurigkeiten. Ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, aber es war einiges, was raus musste. Angesammelt aus meiner kleinen Welt und der großen da draußen. Der Engel hatte offenbar alle Zeit der Welt und sein Gewand bekam unterdessen einen Rotzflecken nach dem andern.
Hier ist ein Taschentuch. Ergriff er wieder das Wort. Und übrigens: anscheinend hat irgendjemand zu dir gesagt, dass du alles alleine schaffen musst. Und siehe, ich verkündige dir große Freude: das ist absoluter Quatsch. Du musst gar nichts alleine schaffen. Und du bist alle Liebe wert. Auch dir ist heute der Heiland geboren.
Wie und ob überhaupt der Engel wieder weg ging, ich kann es gar nicht sagen.
Weihnachten passiert. So, oder so ähnlich. Und egal wie weihnachtlich man gestimmt ist, oder nicht. Ob man auf göttlichen Besuch vorbereitet ist, diesen vielleicht gar herbei sehnt, oder von Gott (gerade) nichts wissen will. Er kommt, einfach so. Das war damals schon so. Vor gut 2000 Jahren. Der Stall war ja nicht die erste Adresse für Maria und Josef. Eher Notlösung. Es war eben keiner so richtig vorbereitet. Das macht dieses Fest wohl aus. Und es passt zu Gott, dass er trotzdem kommt.
Denn uns ist heute der Heiland geboren.
Geboren, also einer so wie wir. Mit einem Körper, Familie, Freunden, Schmerzen, Freuden und einer Sehnsucht. Von Gott gesandt, damit wir nicht glauben müssen, alles alleine schaffen zu sollen. Mit der irrwitzigen Vorstellung brechen zu können, perfekt sein zu müssen. Die Angst ablegen zu dürfen, im Finstern ohne Licht zu sein. Weihnachten findet statt, weil Gott es so will. Friede für die Menschen, an denen er nun einmal Wohlgefallen hat, trotz allem. Dann ist weihnachtlich sein wohl nichts anderes als, gnädig zu sein, mit sich selbst, und auch mit den anderen – weil Gott es auch ist.
Fühlt euch umarmt.
Das kleine „t“, von Presbyter Jürgen Gerrmann (2025_10)
– Artikel für Christen unterwegs –
Ist Ihnen das auch schon mal so gegangen? „Zufällig“ begegnet einem ein Bibelwort, das einen zuerst stutzen, dann aufhorchen und schließlich aufschrecken lässt Mir ist es neulich beim ökumenischen Pilgern von der Kirche in Weißenbach zur Jakobskapelle in Haldensee wieder mal so ergangen. Als in der Nähe von Nesselwängle schweigendes Gehen angesagt war, ist mir ein Wort aus dem 83. Psalm zugefallen. Dessen dritter Vers lautet: „Schaffet Recht dem Armen und der Waise und helft dem Elenden und Bedürftigen zum Recht!“
Ehrlich gesagt: Mir ist es eiskalt den Rücken hinuntergelaufen, als ich diese Worte beim Weitergehen buchstäblich Schritt für Schritt bedacht habe. Nach meinem laienhaften Wissen sind die so um die 2500 Jahre alt. Was hat sich seither verändert? Hat sich überhaupt etwas verändert? Ich habe da so meine Zweifel daran…
In den aktuellen politischen Debatten scheint es (aus meiner Sicht) mehr um die Schonung der Reichen als um die Unterstützung der Armen zu gehen. Soziale Leistungen werden zur Disposition gestellt, Gesundheit wird mehr um mehr zu einer Sache des Geldes. Und das gilt auch für die Justiz. Die „Elenden und Bedürftigen“ haben nicht die Mittel, um sich bis ins höchste Gericht durchzuklagen oder eine Heerschar von Anwälten zu beschäftigen, die die Prozesse so lange hinausziehen helfen, bis möglicherweise eine Verjährung eintritt oder ein „Rabatt“ wegen der langen Verfahrensdauer gewährt wird.
Ist das Psalm-Wort mithin ein Beleg dafür, dass Gott alles einfach treiben lässt und all die Ungerechtigkeit hinnimmt? Auf den ersten Blick: vielleicht. Nämlich dann, wenn man (wie ich zunächst) einen kleinen, aber entscheidenden Buchstaben übersieht: ein t. Das erste Wort heißt nämlich „schaffet“. Und nicht „schaffe“. Es handelt sich hier also nicht um eine fromme Bitte an Gott, nach der man ihn wieder einen guten Mann sein lassen kann und die Hände bequem in den Schoss zu legen vermag. Sondern um eine Aufforderung, ja einen Auftrag an alle, die dieses Wort gehört haben. Nicht nur vor zweieinhalb Jahrtausenden. Sondern auch heute. Ganz konkret.
Und auch Jesus spricht uns über 2000 Jahre hinweg ganz direkt an (übrigens in der Rede zum Weltgericht): „Was ihr getan habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan!“ Im guten wie im schlechten.
Der Auftrag ist klar: „Handelt!“ Aber wann nur fangen wir endlich damit an?
Warum es sich lohnt, Christ zu sein, von Kuratorin Brigitte Moritz (2025_09)
– Artikel für Christen unterwegs –
Wir hören von den Kirchenaustritten, wir hören von den kirchenfernen Menschen, wir wissen von den Kritiken über die Kirche. Als Mitverantwortliche in der Kirchengemeinde hören wir viele Argumente, die sich gegen die Mitgliedschaft in einer Kirche richten. Sicher hat vieles seine Berechtigung. Trotzdem bin ich eine Verteidigerin in Sachen Christentum und eine Kämpferin für das Verbleiben in der Kirche und der Mitgliedschaft einer christlichen Gemeinde.
Ganz abgesehen von der persönlichen Bereicherung die ich in meinem Leben als Christin erfahren habe, gibt es auch einen gesellschaftlichen Nutzen. Die Grundzüge, die unser heutiges Leben in Europa bestimmen, wurden durch christliche Grundlagen gelegt. Ein Leben in Freiheit und Demokratie wurde von Menschen erkämpft, die christlich geprägt waren. Werte wie unsere Grundgesetzte sind geprägt durch christliche Denkweisen. Natürlich gab es über die Jahrhunderte hinweg auch viele Fehlentwicklungen. Aber das, was wir heute haben, ist eine Entwicklung auf christlichen Hintergrund.
Christsein fordert aber auch die eigene Persönlichkeit heraus und da gibt es für mich drei Dinge, die mir lohnenswert erscheinen und die mich zu einer begeisterten Christin machen.
Da ist die Mitmenschlichkeit die mir vorgegeben ist und für die ich in der Bibel viele Beispiele finde. Ich trage soziale Verantwortung für meine Mitmenschen und meine Umwelt. Ungerechtigkeit, Ausgrenzung und Verachtung gehören nicht zu einem christlichen Leben. Ganz radikal würde ich sagen, wer das verbreitet der verliert seine Menschlichkeit.
Da ist der Umgang mit Schuld. Wir alle wissen um unsere Fehler und Schwächen. Wir wissen auch, wann wir schuldig werden. Das gehört in unser Leben und muss nicht unterschlagen oder beschönigt werden. Gott wird uns in seiner absoluten Treue zu uns Menschen auch dann annehmen und uns frei machen von allem Belastenden.
Da ist der Segen. Wir sind als Christen gesegnete Menschen. Welcher andere Verein oder welche Gruppierung kann uns das bieten. Wir werden gesegnet und dürfen Segen sein. Dieses Geschenk das uns Christen gemacht wird dürfen wir einfach annehmen ohne irgend eine Vorleistung zu liefern. Ist das nicht großartig?
Ich und Pilgern? von Pfarrer Michael Jäger (2025_08)
– Artikel für Christen unterwegs –
Nicht naheliegend, eher eine Annäherung. Natürlich bin ich gerne draußen unterwegs und auch noch Pfarrer. Aber, ich bin eben auch ein bisschen mein eigenes Tempo gewohnt und breche gerne planlos auf, Berge finden sich hier zum Glück ja immer … Da ist Pilgern schon eine ganze andere „Nummer“, erst recht, wenn man Mitveranstalter ist. Ich bin also schon gespannt, auf den 24.9., auf die Tour von Weißenbach ins Tannheimer Tal, gemeinsam mit Alois Gedl und eben denen, die Lust haben, da mit zu gehen. Eine Tagestour auf dem Außerferner Jakobsweg, ökumenisch. Für mich: Schnupper-Pilgern.
Das ist ja schon spannend. Während den christlichen Kirchen die Mitglieder weglaufen, sind deren Pilgerwege, wie eben der Jakobsweg, fast schon überlaufen. Die Motivationen der Wanderer könnten vermutlich kaum unterschiedlicher sein, aber immerhin: Pilgern ist eine christliche Glaubenspraxis, der Weg führt bewusst an ausgewählten Kirchen und Kapellen vorbei und kann sogar an einem mutmaßlichen Apostelgrab in Spanien enden.
Was ist da nur los? Oder, um im Bild zu bleiben: läuft da was schief? Bestimmte religiöse Praktiken scheinen gerade auf einem säkularen Boden wunderbar zu blühen. Die Soziologie spricht dabei von einem „Säkularisierungsparadox“: die Kirche als Organisation wird von immer mehr Menschen verlassen, um stattdessen lieber unbehaust nach neuen Formen individueller Religion zu suchen. Man geht zwar auf einem kirchlichen Pilgerweg, aber um zu sich selbst zu finden.
Beklagenswert? Für mich egal. Rausgehen und aufbrechen ist einfach immer richtig.
Probieren wir es in ein paar Wochen doch gemeinsam. Ich machs ja auch zum ersten Mal. Auf gehts!
Das Licht der Hoffnung, von Presbyter Jürgen Gerrmann (2025_05)
– Artikel für Christen unterwegs –
„Mehr miteinander machen“ – das wünschen sich viele katholische und evangelische Christen schon lange. Am Freitag ist eine wunderbare Gelegenheit, das Miteinander zu genießen: Die Lange Nacht der Kirchen wird im Zeichen der Ökumene gefeiert. Ein Zeichen der Hoffnung. Passt ja. Denn so könnte man ja auch den roten Faden beschreiben, der sich durch diesen Abend und in die Nacht hinein zieht.
„Es ist vielleicht dunkel. Aber die Hoffnung ist ein Licht“, hatte schon Victor Hugo gesagt. Und dieses Wort drückt auch eine Sehnsucht aus, Wir leben in einer Zeit, in der das Dunkel auf dem Vormarsch zu sein scheint: Kriege, Hungersnöte, Teuerung, ein vermeintlich unaufhaltsamer Vormarsch von Kräften, die mit der Demokratie, wie wir sie noch vor zehn Jahren kannten, nichts mehr am Hut haben, soziale Ungerechtigkeit, private und unternehmerische Insolvenzen, Diskriminierung, Lügen und Hetze – von allen Seiten scheint her es Nacht zu werden. Oder ist es bereits. Resignation macht sich breit. Und Ängste noch dazu.
„Ihr, die Ihr eintretet, lasst alle Hoffnung fahren“, hat Dante in seiner „Göttlichen Komödie“ über das Tor zum Inferno geschrieben: Die Hoffnungslosigkeit scheint also eines der Dinge zu sein, die die Hölle ausmacht. Stimmt ja: Keine Hoffnung mehr zu haben, kann einem wahrlich das Leben zur Hölle machen.
Aber dabei muss es nicht bleiben. „Meine Hoffnung und meine Freude“, beginnt ein wunderschönes Lied aus Taize, das auch „Christus, meine Zuversicht“ besingt. Es gibt für uns Christen also einen Weg aus der Hoffnungslosigkeit. Und aus der Hölle.
Als ich darüber nachdachte, bin ich aber auch stutzig geworden: Mir ist kein einziger Text eingefallen, in dem Jesus explizit das Wort „Hoffnung“ verwendet. Aber dann kam mir in den Sinn: Taten sind ja oft wichtiger als Worte. Jesus hat das Reich Gottes voll Frieden und Gerechtigkeit verkündet, das ewige Leben verheißen, das Vertrauen in die unendliche Liebe Gottes zu den Menschen gepredigt und ist auferstanden: Im Grunde war er ja die personifizierte Hoffnung.
Das spürten wohl auch die ersten Christen. Denn in den Briefen des Apostels Paulus, die diese oft verängstigten und auch verfolgten Gemeinden stärkten, wimmelte es nur so von diesem Wort. Ersparen wir uns jetzt eine genaue Quellenangabe, sondern lassen wir die Botschaft (ohne weitere Verästelungen der Texte) einfach mal so auf uns wirken – ganz direkt: „Die Hoffnung lässt uns nicht zuschanden werden. Wir rühmen uns der Hoffnung der zukünftigen Herrlichkeit Gottes. Seid fröhlich in der Hoffnung! Die Hoffnung liegt für Euch bereit im Himmel. Der Gott der Hoffnung erfülle Euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass Ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes! Am Ende bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe – diese drei. Lasst uns festhalten am Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken!“ Und so weiter und so fort.
Die Konsequenz für mich: Wenn wir als Christen unterwegs sind, sollten wir nie vergessen, dass wir die Hoffnung mit im Gepäck haben. Nicht nur als eiserne Ration. Sondern zum täglichen Gebrauch. Der kleinste Lichtstrahl davon überwindet das größte Dunkel: Wir sollten öfter daran denken. Nicht nur in der Langen Nacht der Kirchen…
Fromm sein, ist das noch aktuell?, von Kuratorin Brigitte Moritz (2025_05)
– Artikel für Christen unterwegs –
Vermutlich kennt jeder aus seiner Kinderzeit das Gebet „lieber Gott mach mich fromm, dass ich in den Himmel komm“. Solche Sätze sind heute überholt und nicht mehr haltbar. Hinter Fromm und Himmel sind heute ganz andere Begrifflichkeiten zu verstehen. Fromm ist ein altmodischer Ausdruck und wir können mit dem Begriff kaum noch was anfangen. Junge Menschen schauen ratlos, wenn wir sie danach fragen. Würde ich diese Bezeichnung noch für mich gebrauchen? Halte ich mich für fromm? Ich würde doch eher die Begriffe religiös oder gläubig verwenden. Können wir uns noch vorstellen, dieses Wort zu benutzen. Ist man heute noch fromm. Als gläubiger Mensch zeige ich, dass ich meine Religion wichtig nehme. Ich versuche den Glauben an Gott in meinem Tun und Wirken sichtbar zu machen. An Gott zu glauben bedeutet für Werte wie Nächstenliebe, Wahrhaftigkeit und soziale Verantwortung einzustehen. Christ sein muss immer auch eine Aussenwirkung haben. Wie zeigt man fromm sein nach aussen?
Im Gegensatz zu diesem sichtbar werden und wirken nach aussen, geschieht beim Fromm sein etwas anderes. Fromm wirkt in mir selbst. Es bedeutet zu vertrauen und zu glauben, dass Gott auf unsere Leben einwirkt. Fromm sein heißt, ich vertraue den Geschichten der Bibel, ich glaube an die Verheißungen und Aussagen. Die Wissenschaft erklärt uns heute so vieles, dass es schwer wird, Gottes Wirken seinen Raum zu lassen. Wie bringen wir Urknall und Schöpfung zusammen. Wie bringen wir das leere Grab von Ostern und die eigene Auferstehung zusammen. Viele Fragen und Erkenntnisse erschweren uns heute ein Christ zu sein. Glaube braucht mehr als Gewissheit. Glaube braucht auch Vertrauen. Wir vertrauen als Christen einer Macht, die uns Menschen begleitet und behütet und von der wir gewollt sind. Vielleicht hilft das altmodische Wort „fromm sein“ das anzunehmen, was unser Verstand nicht einsehen kann. Vielleicht ist fromm sein doch nicht so altmodisch wie es zuerst klingt, denn es hilft die Großartigkeit Gottes zu verstehen.
Volle Kanne, aber nicht breitbeinig, Ostern feiern!, von Pfarrer Michael Jäger (2025_04)
– Artikel für Christen unterwegs –
Frauen. Wieder einmal Frauen, die etwas früher mitbekommen als die Männer. In diesem Fall, dass das Grab leer ist. Und dabei bleibt es nicht. Sie bekommen auch noch als erste den Auftrag, diese Botschaft – erst jetzt kommen die Männer ins Spiel – den Jüngern und Petrus auszurichten. Leichter gesagt als getan. Die Frauen sind ordentlich erschrocken und bekommen zunächst einmal kein Wort über die Lippen. Mehr als verständlich. Wie soll man etwas beschreiben, wofür es keine Worte gibt?
So wird in der Bibel das Ostergeschehen erzählt. Ostern, Fest der Auferstehung, Tag der Halleluja-Klänge. Und die Jahreszeit schiebt gewaltig mit an. Die Natur bricht auf und das Leben sich Bahn. Was neues Leben bedeutet, Aufbruch, Abgestorbenes hinter sich lassen, richtig Farbe ins Spiel bringen, mit Energie förmlich bis zum Platzen aufladen, das zeigt überaus eindrucksvoll der Frühling. Jedes Jahr neu ein Fest. Für mich fast die schönste Jahreszeit. Verheißung des Sommers. Ostern kann man immer feiern, aber in den Frühling passt es so richtig rein.
Bei den Frauen, es handelt sich um Maria Magdalena, um eine weitere Maria, die als Mutter des Jakobus ausgewiesen wird, und Salome, bricht aber etwas ganz anderes auf, mit aller Gewalt, und zwar Zittern, Angst und Sprachlosigkeit. Sie rennen hinaus. So endet das Markus-Evangelium, das älteste der 4 Evangelien, in seiner ursprünglichen Fassung. Kein Halluluja, oder alles entspannt und in bester Ordnung. Nein, die christliche Botschaft ist eingebettet ins Leben der Menschen, und da kann es nun mal so viel Verzweiflung geben, dass diese den Menschen die Sinne für sie verlegt.
Ist vielleicht diese Überforderung der ersten Osterzeuginnen selbst ein Teil der befreienden österlichen Botschaft? Sind wir denn Ostern gewachsen? Natürlich, das mit den Ostereiern bekommen wir schon hin, die einen bemalen, die anderen verstecken. Ein paar nette Bräuche dazu und ein üppiges Osterfrühstück, gerade wenn man zuvor gefastet hat. Diverse Leckereien bieten sich an, ob nun der Osterfladen oder die Colomba, der Osterhase. Den Kindern Geschenke machen, schließlich ist Weihnachten schon wieder eine Weile her und für Geschenke haben Kinder ohnehin eine gewisse Grundoffenheit … Wie man Ostern feiert, ist halbwegs klar.
Aber Ostern verstehen? Begreifen? Was diese Explosion an Bräuchen und Feiern ausgelöst hat? Nicht so einfach. Österlicher Glaube braucht Zeit. Jesus aufsuchen wie die Frauen, Jesus suchen – ja, das geht schon gut. Die von ihm erzählten Geschichten berühren. Seine Predigten und Gleichnisse fordern unsere Denkgewohnheiten heraus. Aber ihn als den Auferstandenen sehen? Das war für die Frauen damals nicht einfach, und das ist es uns heute ebenso nicht. Zu verstehen, dass diese Welt noch eine andere Dimension hat, und nicht der Tod das letzte Wort. Hinter der oft so drückenden, dominierenden Realität des Todes noch eine andere ahnen – das will erst einmal geglaubt werden.
Dabei kann ich es mir umgekehrt kaum vorstellen, wie es ohne diesen Glauben gehen sollte. Wie man all dieses Leid und die Ungerechtigkeit in dieser Welt aushalten, wo man Hoffnung hernehmen könnte, gäbe es nicht das leere Grab und die Frauen, die plötzlich vor etwas Unfassbarem stehen. Der Stein konnte den Lebenswillen Gottes nicht bändigen. Der Tod nicht das Leben ein für alle Mal beschließen. Nach 3 Tagen war Schluss mit seiner Macht. So muss es sein. Schlimm genug, dass er so wüten darf, so unzählig oft so unsinnig verursacht und zugemutet wird.
Gott muss wieder auf den Plan treten. So wie auf den ersten Seiten der Bibel beschrieben wird, dass er die Welt und alles auf ihr ins Leben gerufen hat, so lesen wir auf ihren letzten Seiten, dass Gott die Tränen der Menschen aus den Augen wischen wird und Tod, Leid und Geschrei ihr Ende finden. Nur mit dieser Klammer, mit dem von Gott gesetzten Anfang und dem von ihm gemachten Ende, ist all das Dazwischen halbwegs ertragbar. Und auch davon können wir in der Bibel ganz anschaulich und realistisch lesen. Was das Leben so ausmacht, das Schöne wie den ganz normalen Wahnsinn. Die Begeisterung Adams als er zum ersten Mal Eva sieht, wie die blutigen Kriege der Israeliten mit allen möglichen Nachbarn.
Das volle Leben, mit allem Drum und Dran, aber an seinem Ende eben kein Western, alle liegen tot vorm Saloon, sondern Ostern, alle stehen wieder auf. Gott sei unendlich Dank.
Ein Fest, das wir also mit Freude und allen möglichen Bräuchen feiern sollten, überschwänglich, aber zugleich demütig bescheiden. Denn ein voller Mund und breite Schultern stehen uns Gläubigen, uns Suchenden nicht gut zu Gesicht. Wir sind bedürftig. Gott selbst muss uns immer wieder über die Schwelle des Zweifels heben, uns entgegenkommen und so das Vertrauen in seine und auch unsere Auferstehung wachsen lassen. Was wir in der Zwischenzeit tun können, ist, die Zeit ein wenig zu nutzen, um anderen beim Aufstehen zu helfen. Damit nicht Furcht und Zittern in dieser Welt den Ton angeben, sondern das Halleluja der Befreiten.
Oh weh, jetzt sind die Ferien zu Ende …, von Pfarrer Michael Jäger (2024_09)
– Artikel für Christen unterwegs –
Eigentlich darf man sich nicht beschweren, sie sind lang genug gewesen. Aber hätten sie noch ein wenig länger gedauert, hätte man das schon auch irgendwie ausgehalten.
Meine Kinder haben beim Umzug von Bozen nach Reutte genau nachgerechnet. Welche Ferien gab es in Südtirol und welche gibt es nun in Nordtirol und wie lange dauern die jeweils. Das sollte ermitteln helfen, wo es sich letztlich als Schülerin oder Schüler leben lässt. Natürlich sind die Ferien nicht alles. Das Schülerleben wird schon noch von genügend anderen Faktoren bestimmt, aber davon verschaffen die Ferien ja gerade ein wenig Abstand.
Egal wie gleichmäßig, lang oder kurz sie sich nun über das Jahr verteilen, diese Pausen sind unglaublich wichtig. Der Schulalltag kostet Kraft. Das frühe Aufstehen fällt allmorgendlich schwer, erst recht, wenn es noch dunkel ist und man als Fahrschüler nochmal früher weg muss. Und wenn man dann endlich angekommen ist, geht es ja erst richtig los. Ein Fach jagt das andere, ein Lehrer folgt dem anderen. Der Platz in der Klassengemeinschaft will erkämpft werden und Noten gibt es ja auch noch – von der Erwartungshaltung der Eltern ganz zu schweigen.
Alles in allem – wenn man so will – eine angemessene Vorbereitung auf das Leben. Denn all das bleibt ja, kommt nur in neuen Gewändern wieder. Es ist halt dann kein Klassenzimmer mehr, sondern ein Großraumbüro oder eine Betriebshalle. Aus Klassenkameraden werden Arbeits-Kollegen und von Chefs wimmelt die Welt ja ohnehin. Leistungsdruck, Prüfungen, Angst zu versagen – wem ist das fremd? Was es nur nicht mehr so geregelt gibt wie in der Kindheit, das sind die Schulferien und die freien Wochenenden.
Schade eigentlich. Im biblischen Schöpfungsbericht stellt man sich Gott ganz menschlich vor. Nach sechs Tagen der Arbeit ruht er sich am siebten Tag aus. Vorbildhaft. Gott sei Dank gibt es den Sonntag, für uns und unsere Familien und Freunde. In ein paar Tagen ist es wieder so weit.
Was ist in meinem Herzen, von Kuratorin Brigitte Moritz (2024_07)
– Artikel für Christen unterwegs –
Was haben wir Menschen eigentlich in unserem Herzen? Nehmen wir noch wahr, was unser Herz uns sagt, und was es vielleicht auch fordert. Hören wir noch auf Herzensgüte, strahlen wir Herzlichkeit aus. Ganz abgesehen von der medizinischen Leistung, die das Herz jeden Augenblick unseres Lebens leistet, gibt es doch auch die ideelle Vorstellung, dass das Herz Empfindungen hat, die wir mit Worten und Gesten nach außen tragen. Wir Menschen haben ein Herz um Gefühle zu zeigen. Wir kommunizieren mit anderen, wenn wir herzlich lachen. Oder wir verstärken eine Anteilnahme, weil es von Herzen kommt.“ Ich danke dir von Herzen“ ist eben mehr als nur ein „Danke“.
Ich bin davon überzeugt, dass in unseren Herzen viel Gutes ist. Rücksicht und Anteilnahme kommen aus unseren Herzen. Aber lassen wir es auch heraus.
Wenn wir Menschen erleben, die voller Hass ihre Meinung äußern. Wenn Jugendliche sich im Netz anfeinden und bloßstellen. Wenn Fakenews die Medien beherrschen. Die Lüge wird als Wahrheit verkauft und Lügen ist kein Makel mehr. Unser Umgangsstil ist so gnadenlos hart geworden. Rücksicht ist nicht mehr modern.
Trauen wir unseren Herzen wieder mehr zu. Beachten wir mehr das Gute das wir zu geben haben. Binden wir unser Herz bewusst in Entscheidungen ein. Hören wir – bevor wir den Mund aufmachen – auf die Herzlichkeit, die in uns steckt. Und bevor wir Entscheidungen treffen sollten wir unser Herz fragen, ob wir das wirklich so machen möchten. Unsere Welt könnte besser sein, wenn wir mehr auf unser Herz hören würden. Der Prophet Jesaia (Vers 46,12) fordert die Menschen auf „hört mir zu, ihr trotzigen Herzen, die ihr fern seid von der Gerechtigkeit“. Im Römerbrief (Vers 10,10) wird den Menschen dann in einem versöhnlicheren Ton ein Angebot gemacht: „wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht“. Wir bekommen hier ein gutes Versprechen. Gerecht zu sein heißt doch auch Menschlich zu sein. Na dann, hören wir doch mal genauer hinein in unser Herz.
Inmitten, von Pfarrer Michael Jäger (2024_03)
Inmitten all der Leiden dieser Welt, zwischen Schmerzen und Klagen, unfassbar, unerträglich, schon das einzelne Schicksal, erst recht in der Summe. Inmitten aller menschlichen Not dieses eine Leiden, dieser eine Mensch. Mit Mutter und Familie, Freunden und Gegnern, Freuden und Ängsten. Voller Ideen und Ideale, mit Glauben und einem Vater im Himmel. Ein Mensch, wie so viele andere auch. Am Ende verraten, verlassen und verspottet, gefoltert und ans Kreuz gehängt.
Inmitten all der Gräber dieser Welt, den kunstvollen Mausoleen und den unauffindbaren, den geschmückten und denen, die niemand graben konnte, oder wollte. Ist da dieses eine Grab, großzügig geliehen und mit einem Stein verschlossen.
Inmitten all der Morgen dieser Welt. Freudig erwartet, oder lustlos begonnen. Voller Fragen und Leerstellen, Tatendrang und Termine. Ist da dieser eine Morgen.
Drei Frauen machen sich auf den Weg. Ihr Herz ist schwer. Sie trauern um einen Menschen, der ihnen alles bedeutet hat. Ein Teil ihres Lebens, unwiederbringlich verloren. Sie hatten fast gemeint, durch ihn den Himmel offen zu sehen. Damals. Jetzt wie eine Ewigkeit her.
Inmitten all der Enttäuschungen, die Menschen aller Zeiten und Orte so gut kennen, dieser eine Morgen, der anders war, als alle anderen. Die Welt auf den Kopf gestellt. Nichts mehr so, wie es einmal war. Das Grab leer. Der Stein weggerollt. Licht, eine Gestalt, eine Botschaft, Frauen anvertraut: Er ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Gott hat es so gewollt.
Und das ist erst der Anfang.
Frohe Ostern!
Die Kraft in den Schwachen, von Presbyter Jürgen Gerrmann (2024_03)
– Artikel für Christen unterwegs –
Ich kann nicht singen. Ich kann nicht tanzen. Ich kann nicht Skifahren. Ich kann nicht Eislaufen. Ich kann nicht kochen. Schon wieder habe ich bei der Arbeit einen Fehler gemacht. Einmal mehr bin ich zu spät gekommen. Was sollen denn bloß die Leute von mir denken?
Mein Glaube ist nicht gut genug. Ich habe heute vergessen zu beten. War am Sonntag nicht in der Kirche. Und sowieso sind da immer wieder diese Zweifel, die mich unversehens überfallen, obwohl ich doch vertrauen soll. Was soll denn bloß Gott von mir denken?
Perfektionismus ist eine der großen Geißeln unserer Zeit. Unzählige Ratgeber boomen, in denen uns vermittelt werden soll, wie wir uns selbst „optimieren“ und in diesem oder jenem absolut perfekt sein können sollen.
Aber stellen wir uns im Grunde damit nicht selbst ein Bein? Verengen wir unseren Blick dadurch nicht auf unsere Fehler und das, was wir nicht können, nicht tun oder nicht getan haben, und sind dadurch blind für all das Gute und Schöne, das in uns und an uns lebt und weit überwiegt?
Wir schämen uns vor anderen, weil wir nicht perfekt sind – ohne je darüber nachzudenken, ob die überhaupt wollen, dass wir perfekt sind.
Und das zieht sich sogar in unseren Glauben hinein. Auch da fragen wir uns immer wieder, ob wir wirklich „gut genug“ für Gott sind. Das kannte auch Martin Luther, den die Frage „Wie finde ich einen gnädigen Gott?“ regelrecht zermarterte. Und trotz der Botschaft der Reformation sind auch wir Evangelischen selbst mehr als 500 Jahre danach nicht vor diesen beiden Fragen gefeit.
Da tut es ab und zu gut, wenn einem ein kleines Büchlein in die Hände fällt. In einem davon hat Paolo Scquizzato, ein katholischer Priester aus dem Piemont mit großem Herzen für die Ökumene, das „Lob des unvollkommenen Lebens“ (so der Titel) gesungen.
Er weist dabei unter anderem darauf hin, dass sich Gott von Anfang an den Unperfekten, ja Schuldbeladenen offenbart: Adam und Eva lässt er nach dem Sünden-Fall nicht fallen, er gibt nicht einmal den Mörder Kain der Vernichtung preis und selbst David, der als sein „Liebling“ gilt, war (wie dessen Geschichte mit Betseba zeigt), alles andere als perfekt. Und auch Jesus empfand zu den Zöllnern, Aussätzigen, Ausgestoßenen und sogenannten „Sünderinnen“, auf die man mit dem Finger deutete, eine weit größere Nähe als zu den Perfekten.
Gottes unbedingte Liebe zeigt sich (wie ja auch unter uns Menschen) gerade darin, dass wir nicht perfekt sein müssen. Sondern so sein dürfen, wie wir sind.
Seine Worte aus dem 2. Korintherbrief gelten eben nicht nur für den Apostel Paulus (auch einen Unperfekten also), er richtet sie auch an uns: „Lass Dir an meiner Gnade genügen! Denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig!“
Stressen wir uns also nicht mit dem Hang und Drang zur Perfektion. So schwer das sein mag: Lassen wir uns an seiner Gnade genügen! Werden wir statt irgendwelchen mentalen Klimmzügen still und ruhig. Und spüren wir die Kraft, die gerade in uns Schwachen mächtig ist.
Haben oder Sein, von Kuratorin Brigitte Moritz (2024_02)
– Artikel für Christen unterwegs –
Als Erich Fromm sein Buch „Haben oder Sein“ im Jahr 1976 veröffentlicht hat, waren die Zeiten anders. Das Buch war damals ein hilfreiches Mittel über sein Leben nachzudenken. Es bot Orientierung für die Zukunft. Wenn ich heute das Buch in die Hand nehme, dann merke ich, dass es immer noch aktuell, ja vielleicht sogar brisanter als damals ist. Auch heute hinterfragen die beiden Begriffe Haben und Sein unser Leben. Auch das Christsein betrifft Aspekte, die unter diesen beiden Richtungen gesehen werden können.
Da ist das Haben. Gemeint ist damit die Organisation Kirche mit ihren Gesetzen, mit der ganzen Verwaltung, dem Finanzapparat, den weltlichen Strukturen. Eben all die Themen, an denen wir uns reiben und immer wieder ärgern. Oft sind diese Inhalte das Thema unserer Kritik. Dieses Missfallen führt dann eben auch manchmal zum Kirchenaustritt.
Das Sein ist unser Glaube an Gott, an Jesus und den Heiligen Geist. Das Sein ist unsere geistige Haltung zu unserem Glauben. Wie nehmen wir die Worte und Geschichten der Bibel auf. Welche Verantwortung haben wir in der Umsetzung der Texte. Gestalten wir unser Leben in Sinn der Nächstenliebe und den zehn Geboten. Vertrauen wir den Worten der Bergpredigt. Wie wird unser Christsein erkennbar.
Ein kritisches Hinterfragen der kirchlichen Organisation ist gerechtfertigt. Wie bei allen Organisationen muss man immer wieder Sinnhaftigkeit und Berechtigung hinterfragen. Insbesondere wenn Skandale und Misswirtschaft auftreten. Immer wieder werden Machtpositionen missbraucht. Statt transparenter Aufarbeitung wird verschleppt oder verschleiert. Das alles sind Dinge, die verärgern. Sie bringen einen dazu, sich von der Organisation Kirche zu distanzieren oder zu trennen.
Nun ist mir aber ganz wichtig, dass man wirklich unterscheidet zwischen Kirche und Glauben, oder wie Erich Fromm es ausdrückt, zwischen Haben und Sein. Also nicht nur über die Kirche schimpfen, sondern auch den Sinn unseres Glaubens sehen. Die Aufmerksamkeit auf die Beziehung mit Gott lenken und fragen, wann hat mich Gott geärgert oder enttäuscht. Ist mein Glaube so sinn- und kraftlos, dass ich mich davon distanzieren will. Wenn wir unsere Wahrnehmung in diese Richtung lenken, dann erhalten wir hoffentlich ein ganz anderes Bild von Kirche.
Es ist gut sich immer wieder diese Unterscheidung zwischen Kirche und Glauben bewusst zu machen und dann erst zu handeln. Die Zeiten heute sind schwierig. Werte verrutschen, die Frage nach Sinnhaftigkeit wird übergangen, Lügen werden als Wahrheit verkauft. Bleiben Sie ihrer Kirche und ihrem Glauben treu. Hier findet sich noch Orientierung zwischen Haben und Sein.
Brigitte Moritz, Kuratorin
Gedanken zur Ökumene von Pfarrer Michael Jäger (2024_01)
Ich mag die Gebetswoche zur Einheit der Christen, jedes Jahr, Mitte/Ende Januar. Das Zusammentreffen mit den Geschwistern – ein Vergnügen. Man muss ja nicht alles mit ihnen gemeinsam machen. Aber ab und zu, da ist es dann gleichermaßen das natürlichste von der Welt und etwas ganz Besonderes.
Wie mit meinem Bruder. Wen der zu Besuch kommt – wir handhaben das immer so rum, da er seit Jahrzehnten in Soest wohnt und ich bislang immer nach unserem gemeinsamen Verständnis die attraktiveren Wohnorte hatte und habe – ist es wie ein kleines Fest.
Das Fest der Ökumene 2024 feiern wir in Reutte also am 19. Januar, um 19 Uhr in St. Anna. Ich bin gespannt, wer kommt. Noch ist auch nicht geklärt, wie viele Veranstalter wir sein werden. Katholisches Dekanat Breitenwang und Evangelische Pfarrgemeinde Reutte sind schon mal am Start. Das steht fest, wie auch das diesjährige Motto:
„Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und deinen Nächsten wie dich selbst“ (Lk 10,27)
Es ist ja ein Dreieck. Die Liebe zu Gott, zum Nächsten und auch zu sich selbst. Gut, wenn es ein halbwegs gleichschenkeliges Dreieck ist. Nicht eine Pyramide, oder passender zur Zeit, ein Tannenbaum. Eine Spitze ganz oben und alles andere ist untergeordnet.
Ich glaube, nur in diesem Dreiklang klingt die Liebe richtig gut. Wenn man nur an andere denkt, und nicht auch an sich selbst und Gott, kann man leicht an Grenzen kommen, oder gar ausbrennen. Richtet man sich ganz auf Gott aus, auf den Gott, wie man ihn so zu erkennen meint, und verliert den liebevollen Blick auf die Nächsten und sich selbst, ist der Fanatismus nicht mehr weit – und den sehe ich wiederum ganz weit weg von dem Gott, wie ich ihn in der Bibel finde. Und über Menschen, die ihr eigenes Ich ganz oben anstellen, brauche ich wohl nicht extra zu schreiben. Sie sind rasch einsam da oben.
Also, es wird sich sicher lohnen, sich gemeinsam ins christliche Gleichgewicht bringen zu lassen. Am 19. Januar die Andersartigkeit der Geschwister erleben und sich zugleich mit ihnen verbunden wissen, als Kinder des einen Gottes, der sich selbst in einer Nacht – wir nennen sie die Heilige Nacht und feiern sie hier immer am 24.12. – entschieden hat, die Welt zu lieben.
Advent heißt Abschied von Pfarrer Michael Jäger (2023_12)
Nein,
Advent meint Ankunft, so heißt es doch.
„Gott kommt an.“
Doch es gibt keine Ankunft ohne Abschied.
Das Kirchenjahr kleidet den Advent Lila.
Einkehren, umkehren, anders werden.
Zeit, ein wenig in mir wieder Ordnung zu machen.
Ein wunder Punkt.
Sowieso, aber aktuell bei mir noch mehr als sonst.
Denn von Ordnung machen, habe ich in diesem Jahr genug.
Bis alles in Reutte halbwegs wieder seine Ordnung hatte …
Ordnung in den Arbeitsablauf bringen.
So viel Neues.
Dann noch in Österreich
Umzugskisten waren nützlich.
Aber auch der Recyclinghof und die Kleinanzeigen.
Sachen, Aufgaben und auch Menschen zurück lassen.
Sie hatten ihre Zeit.
Jetzt ist Neues dran.
„Gott kommt an.“
Das macht was.
Das stellt alles auf den Kopf.
Das ist mehr als Umzug und neues Autokennzeichen.
Gott wird Mensch.
Will uns ganz nahe sein.
In uns Wohnung nehmen.
Wer hätte sich so etwas ausdenken können,
als Gott allein.
Deshalb beherzt Abschied nehmen.
Advent heißt Abschied.
Gewohnheiten, Trägheiten, Gedankenlosigkeiten …
hinter sich lassen, entsorgen.
In sich Platz machen.
Frei haben für das Neue.
Damit Gott Raum hat in mir.
Und meine Seele ankommt in Gott.
Einen gesegneten Advent
Pfarrer Michael Jäger